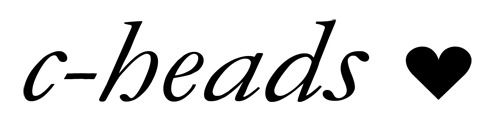Lissabon, den 24.10.2018
– LEKTION –
Text & Photography by Konstantin Arnold
Ich könnte minutenlang dasitzen und in die Luft starren, bis die Minuten zu Stunden und die Stunden zu Tagen werden. Ohne an einer Zigarette zu ziehen, die Menschen erlösen würde, ihnen das Gefühl gäbe, ich würde etwas Sinnvolles tun. Ich könnte stundenlang Brüste unter einem Wollpullover beobachten, den Rundungen beim Runden zu schauen. Bis aus dem Pullover Unterwäsche und aus der Unterwäsche nackter Busen werden würde. Und ich könnte wochenlang durch einen kalten, klaren Herbsttag laufen, immer dem kondensierten Atem nach, bis der Herbst zu Winter und der Winter dann zu Sommer werden würde. Wochen zu Monaten, Monate zu Jahren. Ich habe viel gesehen, war schon weit weg und nah dran, kenne mich aus in der Welt und habe Bilder gemacht, die hoffentlich ein Teil von mir geworden sind, obwohl ich nie darauf verlinkt wurde. Wenn ich etwas tue, stelle ich mir oft vor, ich würde es nicht tun. Und umgedreht. Angst habe ich auch manchmal, manchmal wenn mir irgendetwas etwas bedeutet. Ich kann meine Gedanken nur schwer vergessen und habe moralische Ansprüche, an denen ich so oft gescheitert bin, dass sie sich endlich auf mein Niveau herabbegeben haben.
Ich selbst bin sportlich, breit von Natur aus, volles dunkelblondes Haar. Großgezogen von einem Model von Mutter, die meinte, Männer sollten um Himmelswillen nicht schön sein, sondern Geschichten zu erzählen haben. Daher mein windelweicher Kern. Ich bin jung, obwohl die Jüngeren wahrscheinlich sagen würden, dass ich schon alt wäre. Ich lebe schnell, voll, viel, noch schneller und das am liebsten an vielen verschiedenen Orten mit vielen verschiedenen Menschen. Die nicht verschiedenen Menschen sagen, ich wäre rastlos, hätte mich aber in Lissabons Gassen wiedergefunden. Gott sei Dank! Ich wohne in einem anderen Land, um frei zu sein und Dinge wahrzunehmen, die mir zu Hause nicht auffallen. Wäre ich in Portugal geboren, würde ich wahrscheinlich in Deutschland leben. Aber so rum ist’s besser. Deutschland ist kühl, sogar im Sommer und die Menschen müssen immer gleich wieder gehen und wenn sie gehen, Essen gehen, dann nur wenn jemand heiratet oder gestorben ist. Die Frauen sind emanzipiert, die Männer pünktlich. Die Wirtschaft boomt, weil die Mittagspause nur eine halbe Stunde dauert und in Portugal lieber alle leicht angesoffen zurück an die Arbeit kehren. Die Menschen lieben ihre Sprache, ihren Wein und leben von einer Höflichkeit, die sich nach innen neigt wie ein ernst gemeintes Kompliment an die Organe. Freundschaften gehen von der Sandkiste bis ins Grab, weit über ausgespannte Freundinnen und nie zurückgezahltes Geld hinaus. Das ist gut, denn je mehr Menschen ich kennenlerne, desto weniger Freunde habe ich. Je mehr ich kennenlerne, desto weniger mag ich.
Ich mag Herbst, keine griechischen Frauen und glaube, dass ich nichts zu sagen habe, deswegen schreibe ich. In mir ist ein Schatz von unschätzbarem Wert verborgen, ein innerer Reichtum, etwas Kostbares, das verloren geht, wenn ich es nicht in echte Sätze packe. In eine zementgegossene Sprache, in Worte mit einer unmissverständlichen Bedeutung, Worte wie Felsen an denen das Gerede zerschellt. All das Gefasel, die immer gleichen Wendungen, zermalmt von einer Wahrheit, die lockt Unanständiges zu sagen, mit dem man die tonbandtreue Kaffeeküchenunterhaltung aus dem Takt in die Luft, in all ihre Buchstaben zersprengen könnte. Denkmäler der Klarheit. Worte so präzise, wie mit einem Skalpell geschrieben. Worte, ohne Echo, die für sich selbst sprechen können, ohne dass man etwas zu ihnen sagen müsste. Worte, die eine Geschichte erfinden, die wahr ist und nicht von Spießigkeit gewollt und von den Blicken anderer großgezogen wurden. Worte, die sich nicht im Ruf einer Sache sonnen, ohne ihren Teil zu dieser Sache beigetragen zu haben. Es nicht genauso anders machen, nur damit es bloß nicht gleich ist. Worte, die benutzt werden wollen und im stillen Detail ihre Weltläufigkeit verwahren.
Keinen Schimmer, ob ich das gut kann, aber es gibt tausend Dinge, die ich schlechter kann. Und dass ich das jetzt besser kann, heißt nicht, dass ich es vorher gut gekonnt habe. Hinter all dem liegt eine Gabe, die zur Last wird, zumindest wenn um mich herum nicht alles beschrieben ist und Eindrücke und Notizen und Manuskripte auf mich einschlagen. Ich habe einen siebten Sinn, ich kann mein Leben aus der Erzählperspektive sehen, durch die Augen eines weisen, alten Mannes, der viel gefickt hat und dem das Leben Abenteuer in die Falten seines Gesichts geschrieben hat. So als würde er im Schaukelstuhl mit vollstem Vertrauen kräftig vor -und zurückwippen und sich warmen Schoßes an seine geladene Pistole und einen Herbsttag erinnern und so gerne noch mal Leiden, Leben, Lieben und sich nie fragen müssen, was wohl gewesen wäre wenn, weil er auch damals volle Pulle vor -und zurückgewippt ist. Er ruft mir zu, mit kaputtgerauchter Stimme, volle Kraft voraus und Gott liebt dich Junge, auch wenn du mal dein Kondom vergessen hast. Es muss schön sein, auf ein so vollbeladenes Leben zurückgucken zu können, aber es ist noch viel schöner, das Leben schon von der Zukunft aus sehen zu können, wenn man gerade dabei ist, es voll zu beladen.
Versuchs mal! Geh und sieh selbst durch die wachen Augen eines weisen, alten Mannes. Augen wie Planeten. Nimm einen kalten, klaren Herbsttag. Muss nicht der erste sein. Einen einfachen Tag im Herbst. Ein Sonntag wäre gut und reine ungeatmete Luft, die ein junger Mann über große Balkontüren ins Schlafzimmer eines Hauses lässt, um sie mit einer jungen Frau zu teilen. Das Haus ragt wie der Bug eines Kriegsschiffes auf eine Kreuzung und vom Balkon aus, könnte man Demokratien verkünden. Es ist ein später Morgen und der Wein hängt ihnen zum Hals raus. Es wird kaum richtig hell und früh wieder dunkel. Die Sonne steht tief, die Schatten lange nicht mehr so scharfkantig wie noch im Sommer. Außer den Dingen, die man lieber tut, anstatt sie zu beschreiben, ist noch nichts passiert, außer der Müllabfuhr. Sie könnten einfach liegenbleiben, müssten heute nicht zum Strand. Ihre Augen sind zu, geschlossene Planeten. Einander noch nicht gesehen, wie damals als sie neben ihm stand und er spürte, dass sie schön ist. Liegend neben ihm. Conchinha. Gäbe es in Lissabon Schornsteine, würde die jetzt rauchen. Draußen ist ein kalter Tag in festen Schuhen, die über trockenes Laub und glattes Pflaster spazieren wollen. Die Hände in den Taschen, das Kinn im Kragen, den Blick auf die Schaufenster gerichtet. Sein Gang ist viel gewaltiger und stärker als ihrer, und manchmal eilt er voraus und sie versucht mitzuhalten und sie machen dann an einem alten Buchladen Rast. Alte Buchläden haben etwas Schicksalhaftes, denkt er. Sie denkt, was er wohl denkt. Beide schauen nach Büchern, die Lissabon so zeigen, wie sie es sehen. Nicht als touristische Kulisse oder als Sehenswürdigkeit, sondern als Ort ihres alltäglichen Lebens, in dem sie aufgewachsen ist und er ein Buch schreibt. Hätten sie ein Ziel gehabt, wären sie nie hier gelandet, hätten nie diese Bücher in ihren Händen gehalten und später nie auf einer Parkbank gesessen und ihre Worte geteilt. Er hat ein Buch gekauft, das scheiße ist und wie froh er ist, dass es scheiße ist. Die meisten Autoren findet er ohnehin scheiße und die, die er gut findet, beneidet er so sehr, dass er sie noch beschissener finden muss. Sie ist da anders. Sie freut sich, wenn er sich Dinge kauft, die ihn hier halten. Auf dem Boden gekaufter Tatsachen. Bücher, Bilder, verstaubter Plunder, der es mittlerweile liebend gerne tonnenschwer machen kann, jemals wieder wegzugehen. Genauso gehen sie hintereinander durch Gassen, die so klein sind, dass kaum ein Straßenname zu ihnen passt. Enge Gassen, die sie frei machen und bis an den Largo de Sao Miguel führen, auf dem er Kastanien kauft, die von Castanheiros geröstet werden und so weit im Süden so etwas wie Schnee sind. Zeichen des Winters, eine Erinnerung daran, dass kein Sommer ist.
Wie jedes Mal zeigt er ihr sein Lieblingshaus, das neben einer großen Korkeiche vor einem Kirchplatz steht, und wie jedes Mal hört sie sich die Geschichte an, als höre sie sie zum allerersten Mal. Er redet dann mit den Augen eines Kindes, mit der Weitsicht eines alten, weisen Mannes, der zwar etwas verrückt ist, für seine Leidenschaft aber gut bezahlt wurde, anstatt an ihr zu scheitern. Das Haus hat große, starke Wohnungen und Balkone zu beiden Seiten. Auf der einen Seite hängen die Äste der Korkeiche und auf der anderen fließt der Tajo und man sieht den Frachthafen, an dem die Welt in Container verladen wird. Zwischen den gefliesten Hauswänden verläuft ein öliger Holzfußboden, der, vom höher gelegenen Kirchplatz aus, gut zu sehen ist und sich in den Lichtern der Stadt spiegelt. Die Möbel sind große schwarze Ungetüme, nicht zu erkennen. Es sind hohe stolze Häuser mit Flussblick, die übereinander ragen und viel besser sein wollen, als die Backsteinhaufen ohne Flussblick, den von Erdbeben vergewaltigten Bruchbuden auf der anderen Seite des Berges. Man sagt, es gäbe auf der anderen Seite des Berges jetzt eine Rolltreppe, die wie ein Zeitstrahl durch den Verfall der Häuser bis auf den Gipfel des Berges führe. Viele der Bars hätten mittlerweile Türsteher bekommen und das Essen der Restaurants würde immer fetter und schlechter werden. Die meisten Terrassen bestünden nur noch aus eingezäunten Ausblicken, die gebaut werden müssen, aber schon Stühle und Tische haben, von denen man sie genießen kann, bis sie endgültig eingehen.
Auf der Sonnenseite des Berges hingegen riecht es nach warmer Nacht. Anblick statt Ausblick. Sie sitzt auf einer Mauer und er lehnt an einem Laternenpfahl. Immer noch am Kirchplatz, immer noch Herbst. Erst wird das Laternenlicht grün, bevor es dann gelb wird. Sie trinken Bier aus Plastikbechern, und rauchen Zigaretten. Er starrt auf ihren Wollpullover. Sie reden mit deutschen und portugiesischen Vokabeln. Er redet am meisten, sie korrigiert. Sie war lange nicht mehr hier, weil er lange nicht hier war. Oft geht er auf Reisen, ohne sie. Aber nie kehrt er ohne ein kleines Geschenk zu ihr zurück. Er reist enthaltsam, nur mit ein paar Büchern, schwarzen Unterhosen, schwarzen Socken, schwarzer Jeans, alles schwarz, nur das Gleiche. Nur seine Jeansjacke ist tabakfarben. Sie hat große Taschen, in denen ein Notizbuch, etwas Geld, eine Schachtel Zigaretten, ein kleines Geschenk und ein ganzer Roman Platz finden. Sie ist alt und abgetragen, genauso wie die Jeansjacken der Marlboromänner im Norden Amerikas alt und abgetragen sind und Flecken haben, die von ihren vielen Abenteuern berichten. So fühlt er sich! Er macht sich etwas aus Mode, will nur nicht drüber nachdenken müssen, weil die Männer im Norden Amerikas auch nicht drüber nachdenken. Wenn ihm etwas gefällt, kauft er es dreifach und die Leute denken, er würde nie die Kleidung wechseln. Sie liebt seine Jacke, weil sie für all die Sehnsüchte, Hoffnungen und Vorurteile steht, die er für sie ist. Diesmal kommt er aus Zürich und hat eine alte Kamera für sie mitgebracht.
Sie reist auch gerne. Am liebsten einer Ausstellung nach oder den Handlungsorten eines Buches hinterher. Seine nächste Reise geht nach Wien. Diesmal wird er sie mitnehmen. Egon Schiele und irgendein Film, der dort spielt. Wenn er zu lang weg ist, streiten sie viel. Dann schicken sie sich meterlange SMS, die in die Ausweglosigkeit führen, bis sie, vom Streit ausgehöhlt, tausende Kilometer voneinander entfernt, völlig erschöpft, in sich zusammensacken. Dann schickt er ihr eine Postkarte, auf die er schreibt, dass er sie vermisse und ihm Portugal fehle und ihm fehle wie sie Portugiesisch spricht und wie ihre Mutter Fischsuppe kocht und das ganze verdammte Gefühl der Vollkommenheit. Wo auch immer er gerade ist. Und sie reden erst wieder miteinander, wenn die Postkarte ankommt.
Mit ihr ist er über einen Punkt hinausgegangen, vor dem er bei anderen Frauen stets zu fliehen versuchte. Mit ihm ist sie endlich wieder gekommen. Er hat sie schon aus den Flammen und aus den Fluten gerettet und sie kann all den Sturm ganz leicht aus seinen Segeln atmen. Beide haben einander zu schätzen gelernt. Beide ziehen sich an und aus. Es gibt kein Ausziehen, ohne eine letzte Scham und keine letzte Scham ohne das Ausziehen. Es ist ein Rätsel, dessen Antwort darin besteht, keine Frage zu finden. Ein Ding auf Abstand, durch den ein Bild von van Goghs, Monets, Urys, von wem auch immer, erst augenscheinlich spürbar wird. Es ist wahrhaftig nicht leicht, für einen Mann eine Frau aufrichtig zu lieben, ohne dass ihm seine Moral, aus Rücksicht, dabei ein Stück weit entgegenkommt. Er begehrt sie und sie begehrt seine Begierde.
Fast wäre er danach mit ihr noch in die alte Trambahn gestiegen. Und sie wären aneinander aus dem Fenster gelehnt durch die Nacht gefahren. Wären da nicht Anakondas von Touristen gewesen, die sie von dieser schnulzigen Tat und die Welt vor einem weiteren schnulzigen Absatz bewahrt hätten. Glaubt man all den für alle Ewigkeit zwischen den Pflastern verloren gegangenen Zigarettenstummeln, gibt es im Viertel mit Flussblick zu dieser Stunde außerdem noch mehr, als ein glücklich besoffenes Liebespaar. Es gibt junge Fado-Sängerinnen, die in Telheiras, dem Vorgarten Lissabons aufgewachsen sind und mit zarten 20 von den Problemen der Alten Mourarias singen, dem vom Erdbeben ins Mittelalter beförderten Backsteinhaufen auf der anderen Seite des Berges ohne Flussblick. Es gibt grüne Parks mit Enten und Eintritt, in dem alle Probleme dieser Erde gelöst werden könnten, weil wilde Enten zeigen, dass alles halb so wild ist. Es gibt Treppenstufen, auf denen man die heißesten Szenen drehen könnte und alte Straßenlaternen, die alles in gelbem Licht erstrahlen. Der Boden ist holprig, nicht für hohe Schuhe und Rollkoffer geeignet und die Luft riecht immer frisch gewaschen, egal wie hoch sich der Müll unter den Wäscheleinen auftürmt. Manchmal gibt es kleinere Ausstellungen zu denen Models kommen, die nicht wissen was ausgestellt wird und Männer mit Haarschnitt und Krawatten, die kaum noch sehen, was nicht ausgestellt wurde. Ein Leben für die Kunst, na klar! Wir schauen zurück und würden uns erhängen, noch bevor wir sterben, wenn es kein freies Leben gewesen wäre. Von jemandem wie ihr hatte er stets geträumt, immer kurz vor dem Einschlafen in all den letzten Jahren. Doch nie würde er die Liebe vor die Kunst stellen und das weiß sie, weil es sonst auch nicht er wäre, den sie lieben würde. Das macht sie traurig und ihn macht es traurig, weil es sie traurig macht. Ihr Herz schlägt zu gut, als dass sie es verbergen könne. Er findet dann die richtigen Worte, weil es immer Worte gibt, die richtig klingen, selbst wenn sie falsch sind und sie glaubt seinen Worten, weil er sie sich selbst glaubt.
Dann schaut sie zu ihm mit einem Blick, der sich einbrennt, wie eine gedachte Fotografie. Beide überkommt ein Hunger, der sie um Mitternacht in ein Bistro treibt. Ein schmaler Raum, eine lange Theke, die Wände gefliest und die Tische folgen wildgewordenen Geometrien. Das Licht ist grell und scheint durch zwei offene Türen auf das Pflaster der Gasse, die sich mit einem kleinen Absatz vom Bistro abzugrenzen weiß. Im Licht stehen Menschen wie Motten. Die Kellner tragen Schnauzbärte und weiße Hemden, die in schwarzen Hosen stecken und über den Tag mit allem Möglichen eingesaut wurden. Sie bestellt Sardinen, er nimmt Vazia mit einem Ei drauf. Obwohl sie weiß, dass man Sardinen eigentlich nur von einem Grill essen sollte, der hinter einem Elternhaus brutzelt und er weiß, dass nichts an die Erleuchtung herankommen wird, die beide im Norden des Landes gegessen haben. Es ist ein schönes Bistro, weil es ein schöner Abend ist. Im Winter, wenn die Winde über die Quadratmeter pfeifen, ein Ort zum Aufwärmen, im Sommer, wenn seine große Balkontüre zum Gewächshaus wird, ein Ort zum Abkühlen. Beide waren sie noch nie zuvor an diesem Ort, der jetzt ihr Ort ist. Er sagt, dass er Menschen schön finde, die alleine dasitzen, ohne auf ihr Telefon zu glotzen, sich mit ihren Gedanken zu beschäftigen wüssten und einfach nur in die Luft starren. Sie sagt, dass es aber auch viele Spanner gäbe, die ihr dann auf die Brüste glotzen würden. Er sagt, dass das ja entsetzlich wäre und räudige Typen seinen müssten. Sie sagt, Männer können eben nur so gut sein, wie sie sind.
Lektionen eines einfachen, klaren Herbsttages. Gesehen durch die zurückgezogenen Gardinen eines großen Fensters, vor denen ein notgeiler alter Knacker sitzt, immer vor –und zurückwippend. Es kommt nicht darauf an, was man daraus gemacht hat, immerhin wären er und sie fast liegengeblieben. Viel wichtiger ist doch, was man darin sieht, welche Worte man wählt, welche Perspektive man trägt und durch welche Augen man das Leben in all seinen stillen Momenten betrachtet. Ich wünsche einen erfolgreichen Herbst. Herzlichst, K. mit 69.